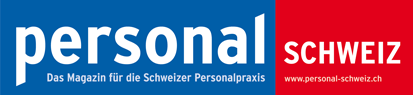- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Sachlicher Kündigungsgrund und Verhältnismässigkeit: Kündigung im öffentlichen Personalrecht
Praxisfälle
Sachlicher Kündigungsgrund und Verhältnismässigkeit: Kündigung im öffentlichen Personalrecht

Ausgangslage / rechtliche Grundlagen
Öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse unterliegen grundsätzlich oder zumindest nicht in erster Linie dem Obligationenrecht (OR), das auf privatrechtliche Arbeitsverhältnisse Anwendung findet und auch definiert, unter welchen Voraussetzungen eine Kündigung zulässig ist. Das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis richtet sich nach den anwendbaren kommunalen, kantonalen oder bundesrechtlichen Gesetzen sowie Verordnungen und unter Umständen anwendbaren Gesamtarbeitsverträgen. Das OR kommt jedoch oftmals subsidiär zur Anwendung.
Im Gegensatz zu privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen besteht im öffentlichen Personalrecht somit keine einheitliche Rechtsgrundlage. Entsprechend sind die anwendbaren (Kündigungs-)Bestimmungen im Einzelfall zu ermitteln.
Für alle öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber gilt jedoch, dass sie sowohl an die Verfassung als auch die rechtsstaatlichen Prinzipien gebunden sind. Dies gilt gemäss verschiedenen Lehrmeinungen selbst dann, wenn es ihnen erlaubt ist, die Arbeitsverträge gemäss dem privaten Arbeitsrecht abzuschliessen.
Die Kündigung im öffentlichen Personalrecht
Entsprechend bedarf eine Kündigung im öffentlichen Personalrecht einer gesetzlichen Grundlage, und sie muss im öffentlichen Interesse liegen. Zudem müssen die Verhältnismässigkeit und das rechtliche Gehör gewahrt bzw. gewährt werden. Ebenso müssen der Grundsatz von Treu und Glauben, das Gleichheitsgebot und das Willkürverbot beachtet werden. Vor diesem Hintergrund finden sich in den verschiedenen öffentlichen Personalrechtserlassen meist ähnliche Voraussetzungen für eine Arbeitgeberkündigung und somit zumindest vergleichbare sachliche Kündigungsgründe.
Die ordentliche Kündigung und der sachliche Kündigungsgrund
Was als sachlicher Kündigungsgrund gilt, wird oftmals in den jeweils anwendbaren Gesetzen, Verordnungen oder Gesamtarbeitsverträgen selbst – in abschliessender oder nicht abschliessender Weise – definiert. In den meisten dieser Erlasse wird für eine ordentliche Kündigung jedoch das Vorliegen einer der folgenden Gründe verlangt (je nach anwendbarem Erlass etwas anders formuliert):
- Ungenügende Arbeitsleistung, wobei dem Mitarbeitenden grundsätzlich vorab eine Frist zur Verbesserung der Arbeitsleistung zu gewähren ist, was meist im Rahmen einer Abmahnung bzw. Verwarnung unter Ansetzung einer entsprechenden Bewährungsfrist geschieht.
- Ungenügendes Verhalten, wobei auch diesfalls in aller Regel vor der Kündigung eine Bewährungsfrist zu gewähren ist.
- Schwere oder wiederholte Pflichtverletzung, wiederum grundsätzlich nach einer erfolgten Abmahnung bzw. Verwarnung.
- Wegfall oder Nichterfüllen einer Anstellungsbedingung.
- Mangelnde Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die Arbeit zu verrichten.
- Längere bzw. wiederholte oder dauernde Arbeitsunfähigkeit. Dieser Kündigungsgrund kommt erst zum Tragen, wenn eine Sperrfrist und/oder der Anspruch auf Lohnfortzahlung abgelaufen ist.
- Aufhebung oder Anpassung der Stelle aus wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen.
Fehlen eines sachlichen Kündigungsgrunds
Der Arbeitgeber hat (im Streitfall) zu beweisen, dass ein sachlicher Kündigungsgrund vorliegt. Der sachliche Kündigungsgrund muss daher ausreichend dokumentiert sein, was insbesondere bei persönlichen Kündigungsgründen wie dem ungenügenden Verhalten, Pflichtverletzungen und mangelhafter Leistungen herausfordernd sein kann, aber umso wichtiger ist. Gelingt dem Arbeitgeber dieser Beweis nicht, qualifiziert die Kündigung als unrechtmässig/rechtswidrig und ist im Grundsatz anfechtbar (und in seltenen Fällen sogar nichtig).
Was für Folgen die Unrechtmässigkeit der Kündigung hat, bestimmt sich nach den im konkreten Fall anwendbaren öffentlich- rechtlichen Personalbestimmungen. Viele dieser Personalrechtserlasse sehen (mittlerweile) im Fall einer unrechtmässigen Kündigung «nur noch» eine finanzielle Entschädigung vor. Dies ist aus Sicht der Autoren zu begrüssen, nachdem die vom Mitarbeitenden behauptete Unrechtmässigkeit der Kündigung in der Regel in einem langen und aufwendigen verwaltungsrechtlichen Verfahren zu klären ist, was nicht nur verhindert, dass die Stelle schnell neu besetzt werden kann, sondern in aller Regel auch zu einer (weiteren) Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses führen dürfte. Verschiedene Erlasse kennen jedoch (nach wie vor und sofern möglich) einen Anspruch auf Weiter- bzw. Wiederbeschäftigung.
Missbräuchliche und fristlose Kündigung; zeitlicher Kündigungsschutz
In Bezug auf die Frage, ob eine Kündigung als missbräuchlich qualifiziert, wird demgegenüber in vielen öffentlich-rechtlichen Erlassen auf die entsprechende Bestimmung im Obligationenrecht verwiesen (Art. 336 OR). Ebenso wird für den zeitlichen Kündigungsschutz (die sog. Sperrfristen) oft auf die entsprechende Bestimmung in Art. 336c OR verwiesen, oder es finden sich analoge Bestimmungen; teilweise geht der zeitliche Kündigungsschutz im öffentlichen Personalrecht aber auch weiter. Die Kündigung, die während einer solchen Sperrfrist erfolgt, ist sowohl im privaten als auch im öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis nichtig.
Hinsichtlich einer fristlosen bzw. ausserordentlichen Kündigung verweisen (fast) alle öffentlichen Personalrechtserlasse auf die entsprechende Bestimmung im Obligationenrecht (Art. 337 OR). Für eine fristlose Kündigung bedarf es eines wichtigen Grunds, der vorliegt, wenn dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Treu und Glauben nicht mehr zugemutet werden darf. Der sachliche Grund ist somit vom wichtigen Grund gemäss Art. 337 OR zu unterscheiden und wiegt weniger schwer.
Betreffend die fristlose Kündigung besteht aber dennoch ein (wichtiger) Unterschied zum privaten Arbeitsrecht. Da im öffentlich-rechtlichen Arbeitsrecht auch vor einer fristlosen Kündigung (unter Umständen weitergehende) Abklärungen getroffen werden müssen und jedenfalls das rechtliche Gehör gewährt werden muss, steht den öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern eine längere Reaktionszeit zur Aussprechung der fristlosen Kündigung zu (im privaten Arbeitsrecht ist diese sehr kurz und beträgt in der Regel nur zwei bis drei Arbeitstage).
Ablauf des Kündigungsverfahrens
Wie vorab aufgezeigt, müssen die Mitarbeitenden bei den in der Praxis oftmals relevanten Kündigungsgründen der ungenügenden Leistung und/oder des mangelhaften Verhaltens in der Regel abgemahnt werden, und es ist ihnen eine angemessene Bewährungsfrist, also eine Frist zur Verbesserung, anzusetzen. Dabei muss so klar wie möglich festgehalten werden, was beanstandet und inwiefern eine Besserung erwartet wird.
Dies ergibt sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip, ebenso wie die Vorgabe, dass vor einer Kündigung grundsätzlich die Weiterbeschäftigung an einer anderen Stelle geprüft werden muss. Die Kündigung muss zudem im öffentlichen Interesse liegen, was der Fall ist, wenn die Weiterbeschäftigung des betreffenden Mitarbeitenden dem guten Funktionieren der Verwaltung/dem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber widerspricht und keine milderen Massnahmen zur Verfügung stehen. Die Kündigung muss als Ultima Ratio ausgesprochen werden.
Auf jeden Fall, d.h. unabhängig vom Kündigungsgrund, muss dem betreffenden Mitarbeitenden vor dem Aussprechen der Kündigung das rechtliche Gehör gewährt werden. Dies bedeutet, dass dem Mitarbeitenden die beabsichtigte Kündigung und die (wichtigsten) Gründe dafür vorab und schriftlich mitzuteilen sind. Dabei wird dem Mitarbeitenden eine Frist angesetzt, innert welcher er sich zur beabsichtigten Kündigung äussern kann. Die Frist beläuft sich oftmals auf zehn Tage; es muss jedoch der konkrete Einzelfall angeschaut werden. Der definitive Kündigungsentscheid kann und darf entsprechend erst gefällt werden, wenn allfällige Einwändes des Mitarbeitenden zur Kenntnis genommen und geprüft wurden. Wird dies nicht gemacht und das rechtliche Gehör verletzt, führt dies zur Anfechtbarkeit der Kündigung und in (absoluten) Ausnahmefällen zur Nichtigkeit der Kündigungsverfügung.
Sofern der Arbeitgeber an der Kündigungsabsicht festhält und sodann eine Kündigung aussprechen will, muss er grundsätzlich eine anfechtbare Verfügung erlassen. Diese und somit die Kündigung müssen – im Gegensatz zum privaten Arbeitsrecht – innert einer relativ kurzen Frist bei den in den anwendbaren Personalrechtserlassen vorgesehenen verwaltungsrechtlichen Instanzen angefochten und es muss in aller Regel der Beschwerdeweg beschritten werden.
Fazit
Anders als im privatrechtlichen Arbeitsrecht ist eine Kündigung durch den Arbeitgeber im öffentlichen Personalrecht nicht ohne Weiters möglich. So bedarf es für eine Arbeitgeberkündigung nicht nur eines sachlichen Kündigungsgrunds, sondern insbesondere das Prinzip der Verhältnismässigkeit ist zu wahren, bevor eine Kündigung ausgesprochen bzw. verfügt werden kann. Dies bedeutet, dass in Bezug auf verschiedene Kündigungsgründe vorab eine Bewährungsfrist angesetzt und jedenfalls das rechtliche Gehör gewährt werden muss.
(Dieser Praxisfall ist in der Ausgabe März 2025 von personalSCHWEIZ erschienen)
- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Sachlicher Kündigungsgrund und Verhältnismässigkeit: Kündigung im öffentlichen Personalrecht