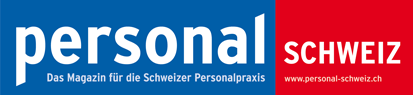- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Öffentlich- rechtliches Arbeitsverhältnis: Strafuntersuchungen und deren Auswirkungen
Praxisfälle
Öffentlich- rechtliches Arbeitsverhältnis: Strafuntersuchungen und deren Auswirkungen

Strafbares Verhalten vor Beginn des Arbeitsverhältnisses
Strafuntersuchungen sind nicht nur dann von Bedeutung, wenn sie sich während des Anstellungsverhältnisses ereignen. Es kommt auch vor, dass die potenzielle Arbeitgeberin bereits im Bewerbungsverfahren Kenntnis einer Strafuntersuchung, einer Vorstrafe oder von sonstigem strafbarem Verhalten erhält, die sich vor dem Anstellungsentscheid ereignet haben. Dies beispielsweise im Rahmen einer Personensicherheitsprüfung, aufgrund der Offenlegung durch die Stellenbewerberin oder durch Medienberichte.
Auch wenn das öffentliche Personalrecht keinen Anspruch auf Anstellung kennt und der Entscheid zur Anstellung oder Nichtanstellung im Ermessen der potenziellen Arbeitgeberin liegt, ist sie bei der Ausübung dieses Ermessens gleichwohl zur Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze verpflichtet. Sie hat ihren Entscheid anhand sachlicher Kriterien zu fällen und muss insbesondere das Rechtsgleichheitsgebot, das Willkürverbot und den Verhältnismässigkeitsgrundsatz beachten. Mit Blick auf die oben erwähnten Ereignisse mit strafrechtlichem Bezug muss sie sich Gedanken zur Arbeitsplatzbezogenheit der Straftat machen, zum Umfang der Aussenkontakte, zur Dauer der Bewährung seit der Straftat sowie zur hierarchischen Position der zu besetzenden Stelle.
Gesamthaft betrachtet ist das Risiko für die Arbeitgeberin, im Falle einer Nichtanstellung von der abgelehnten Bewerberin haftbar gemacht zu werden, aber als gering einzustufen, zumal kein Anspruch auf Anstellung besteht. Viel wichtiger ist es, dass im Falle der Anstellung die zu diesem Zeitpunkt bekannten Elemente mit strafrechtlichem Bezug nicht zur Begründung einer späteren Entlassung beigezogen werden können.
Früheres strafbares Verhalten wird verschwiegen
Anders verhält es sich, wenn die Arbeitgeberin bei der Anstellung keine Kenntnis vom strafbaren Verhalten der Arbeitnehmerin hatte. Ob sie das öffentlich-rechtliche Anstellungsverhältnis bei Kenntnisnahme aufgrund des Verschweigens dieser Tatsachen wieder auflösen darf, hängt letzten Endes davon ab, ob für die Arbeitnehmerin eine Offenbarungsoder Aufklärungspflicht bestand. Von einer solchen ist zum einen dann auszugehen, wenn die Arbeitnehmerin aufgrund des strafbaren Verhaltens in der Vergangenheit nicht geeignet ist, die Arbeitsleistung zu erbringen, also wenn das Delikt arbeitsplatzbezogen ist. Als Beispiel hierfür ist ein früheres Sexualdelikt einer Person zu nennen, die sich für eine Position mit regelmässigem Kontakt zu Kindern bewirbt, oder ein Vermögensdelikt einer Person in der Finanzabteilung. Zum anderen trifft die Arbeitnehmerin in denjenigen Konstellationen eine Offenbarungs- und Aufklärungspflicht, in denen das konkret absehbare Risiko einer Arbeitsverhinderung oder das erhebliche Risiko einer Verminderung der Arbeitsleistung besteht. Dies dürfte z.B. in hängigen Strafverfahren der Fall sein, wenn eine Verurteilung mit Gefängnisstrafe als wahrscheinlich erscheint. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird oftmals eine sofortige Aufhebung des Vertrags unter Berufung auf einen Willensmangel möglich sein – also das Argument, dass die Arbeitgeberin bei Kenntnis der strafrechtlich relevanten Umstände die Arbeitnehmerin nicht angestellt hätte.
Beendigungsmöglichkeiten bei Strafuntersuchungen während des Arbeitsverhältnisses
Die ordentliche Kündigung öffentlich-rechtlicher Anstellungsverhältnisse setzt einen sachlichen Grund voraus. Das Bundespersonalgesetz nennt beispielhaft die Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten sowie Mängel in der Leistung oder im Verhalten. Diese sachlichen Kündigungsgründe gelten grundsätzlich auch auf kantonaler und kommunaler Ebene, auch wenn sie in den einschlägigen personalrechtlichen Erlassen teilweise anders umschrieben werden.
Die Arbeitnehmerin wird bei strafbarem Verhalten während des Bestehens des öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnisses regelmässig gegen die ihr obliegende Treuepflicht verstossen. Konkret wird von der Arbeitnehmerin erwartet, während und auch ausserhalb der Arbeitszeit ein Verhalten anzunehmen, das sich der Achtung und des Vertrauens würdig erweist, das ihre Stellung erfordert. Sie hat alles zu unterlassen, was die Interessen des Staats beeinträchtigt. Insbesondere muss die Arbeitnehmerin alles vermeiden, was das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Verwaltung und ihrer Angestellten beeinträchtigen und die Vertrauenswürdigkeit gegenüber dem Arbeitgeber herabsetzen würde. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das zu beanstandende Verhalten in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist und Aufsehen erregt hat. Es liegt auf der Hand, dass strafbares Verhalten mit der so umschriebenen Treuepflicht regelmässig kollidiert und ein sachlicher Grund zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses deshalb meistens gegeben sein dürfte. Ob die genannten Voraussetzungen, wie z.B. die Beeinträchtigung des öffentlichen Vertrauens, tatsächlich erfüllt sind, muss aber in jedem Einzelfall mit Blick auf das infrage stehende Verhalten geprüft und bewiesen werden.
Wann ist eine fristlose Kündigung möglich?
In schwereren Fällen strafbaren Verhaltens der Arbeitnehmerin dürfte regelmässig eine fristlose Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Debatte stehen. Es gelten im öffentlich-rechtlichen Personalrecht in der Regel die Voraussetzungen des privaten Arbeitsrechts per Verweis. Eine fristlose Kündigung kann dann ausgesprochen werden, wenn das Vertrauensverhältnis zur Arbeitnehmerin aufgrund des strafbaren Verhaltens unwiderruflich zerstört ist, mithin der Arbeitgeberin eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Der Vertrauensverlust erfordert, dass die Arbeitgeberin nach Kenntnisnahme des strafbaren Verhaltens unmittelbar reagiert, ansonsten sie ihr Recht auf eine fristlose Kündigung verwirkt.
Sowohl bei der ordentlichen wie auch bei der fristlosen Entlassung hat die Arbeitgeberin im öffentlich-rechtlichen Personalrecht besonderes Augenmerk darauf zu legen, keine rechtswidrige Verdachtskündigung auszusprechen. Als Verdachtskündigungen werden Kündigungen bezeichnet, die erfolgen, weil die angestellte Person verdächtigt wird, eine strafbare Handlung begangen zu haben, bevor ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt. Würde die Kündigung mit dem Verdacht des strafbaren Verhaltens begründet, wäre dies als ein Verstoss gegen die verfassungsrechtlich garantierte Unschuldsvermutung gemäss Art. 32 Abs. 1 BV zu qualifizieren, die gemäss gefestigter Rechtsprechung auch im öffentlich-rechtlichen Personalrecht von der Arbeitgeberin zu beachten ist.
Allerdings bedeutet das nicht, dass die Arbeitgeberin immer den Ausgang des Strafverfahrens abzuwarten hat, bevor sie einen Entscheid über die Fortführung des Arbeitsverhältnisses trifft. So kann der durch einen Verdacht auf eine schwere Straftat ausgelöste Vertrauenswegfall einen sachlichen Grund für eine Entlassung darstellen, wenn sich der gemachte Vorwurf nicht im strafbaren Verhalten als solchem erschöpft. Ist diese Voraussetzung erfüllt, handelt es sich nicht um eine Vorverurteilung und damit nicht um eine Verletzung der Unschuldsvermutung. Die Arbeitgeberin hat somit darauf zu achten, die Kündigung nicht mit dem Verdacht des strafbaren Verhaltens zu begründen, sondern muss nachweisen können, dass der Verdacht zu einem Vertrauensverlust geführt hat.
Nicht zu vergessen ist, dass die Arbeitgeberin unabhängig von der Art der Kündigung bei ihren Entscheiden dem Gleichbehandlungs- und Verhältnismässigkeitsgrundsatz verpflichtet ist. Demzufolge ist die Auflösung des öffentlichrechtlichen Anstellungsverhältnisses auch bei strafbarem Verhalten der Arbeitnehmerin Ultima Ratio, und es ist vorab zu prüfen, ob der Situation nicht auch mit einer milderen Massnahme begegnet werden könnte. Zudem sind stets die Verfahrensrechte der Arbeitnehmerin zu beachten. Im Zentrum steht das rechtliche Gehör der Arbeitnehmerin, das vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu gewähren ist.
In der Praxis besonders relevant ist ferner die Frage, wie die Arbeitgeberin bei möglichem strafbarem Verhalten überhaupt an diejenigen Informationen kommt, die sie für ihre personalrechtlichen Entscheide benötigt. Die primäre Informationsquelle ist die Arbeitnehmerin selbst, wobei deren Offenlegungspflichten durch ihre eigenen Interessen auf Schutz ihrer Privatsphäre begrenzt werden. Sollte die Anstellungsbehörde selbst aufgrund einer strafbaren Handlung zu Schaden kommen, kann sie sich als geschädigte Person im Strafverfahren konstituieren und auf diesem Weg Einsicht in die Strafakten erhalten.
Wichtig zu erwähnen ist schliesslich, dass die Arbeitgeberin bei personalrechtlichen Entscheiden auf Feststellungen aus dem Strafverfahren abstellen darf. Eine eigene strafrechtliche Würdigung ist aber unzulässig. Vielmehr sind diese Feststellungen stets aus personalrechtlichem Blickwinkel zu betrachten.
Freistellung bei strafbarem Verhalten
Wenn während der Dauer des Arbeitsverhältnisses der Verdacht eines strafbaren Verhaltens der Arbeitnehmerin im Raum steht, stellt sich in aller Regel auch die Frage, ob diese bis zur Klärung der Verhältnisse – sei es durch eine ordentliche oder fristlose Kündigung oder eine Entkräftung des Verdachts – von der Erbringung der Arbeitsleistung freigestellt werden darf. Bei der Freistellung handelt es sich um den einseitigen Verzicht der Arbeitgeberin auf die Inanspruchnahme der Arbeitsleistung der Arbeitnehmerin.
Eine Freistellung ist, anders als im privaten Arbeitsrecht, nicht voraussetzungslos möglich. Die Voraussetzungen ergeben sich aus den einschlägigen öffentlichrechtlichen Personalgesetzen, wobei in aller Regel eine Gefährdung der korrekten Aufgabenerfüllung der Verwaltung vorliegen muss, ein Verdacht oder die Feststellung schwerer strafrechtlich relevanter Vorkommnisse im Raum zu stehen hat. Die Schwelle der Rechtmässigkeit einer Freistellung ist folglich im Vergleich zur Kündigung, wo eine reine Verdachtskündigung rechtswidrig ist, deutlich tiefer. Als weitere Voraussetzung müssen dienstliche Interessen die Freistellung als notwendig erscheinen lassen. Als solche gelten fachliche Interessen, das Vertrauen der Vorgesetzten und der Öffentlichkeit in die korrekte und rechtmässige Erfüllung von Verwaltungsaufgaben sowie das Ansehen der Verwaltung im Allgemeinen. Als letzte Voraussetzung ist auch bei der Freistellung zu beachten, dass diese verhältnismässig zu sein hat. Kommen mildere Massnahmen in Betracht, wie z.B. eine interne Versetzung, sind diese der Freistellung vorzuziehen.
(Dieser Praxisfall ist in der Ausgabe Juni 2025 von personalSCHWEIZ erschienen)
- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Öffentlich- rechtliches Arbeitsverhältnis: Strafuntersuchungen und deren Auswirkungen