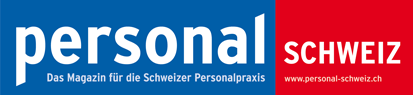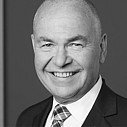- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Mobilität von Arbeitnehmenden: Personenfreizügigkeit im EU-/EFTA-Raum
Praxisfälle
Mobilität von Arbeitnehmenden: Personenfreizügigkeit im EU-/EFTA-Raum
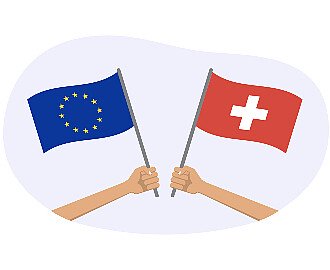
Geografische und berufliche Mobilität
Während für Staatsangehörige aus Ländern ausserhalb der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) strenge Zulassungsbedingungen zum Schweizer Arbeitsmarkt und quantitative Beschränkungen gelten, profitieren Arbeitnehmer aus der EU/EFTA von einem sehr liberalen Mobilitätssystem.
Gestützt auf das 2002 in Kraft getretene Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Personenfreizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) geniessen EU-/EFTA-Bürger geografische und berufliche Mobilität innerhalb der Schweiz. Sie sind somit berechtigt, in die Schweiz einzureisen, ihren Wohnort frei zu wählen und einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Ein Recht auf Personenfreizügigkeit haben sowohl Erwerbstätige (Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende) als auch Nichterwerbstätige (wie z.B. Studierende, Rentnerinnen), die krankenversichert sind und über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um ihren Lebensunterhalt in der Schweiz bestreiten zu können und somit keine Zahlungen der Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu müssen.
Dienstleistungserbringung
Mit dem Freizügigkeitsabkommen wurde die Dienstleistungserbringung während 90 Arbeitstagen pro Kalenderjahr liberalisiert. Das bedeutet, dass Dienstleistungserbringer (Selbstständigerwerbende oder entsandte Arbeitnehmer) während maximal 90 Arbeitstagen pro Kalenderjahr ein Recht auf Einreise und Aufenthalt geltend machen können.
Anerkennung von Diplomen
Um die volle Gewährleistung der freien Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU sicherzustellen, wurde im Freizügigkeitsabkommen auch die Anerkennung von Diplomen, Zeugnissen und anderen Befähigkeitsnachweisen geregelt. Demnach sind ausländische Ausbildungsabschlüsse entsprechend den relevanten unionsrechtlichen Richtlinien als gleichwertig zu betrachten. Die Anerkennung ist an verschiedene Voraussetzungen geknüpft; insbesondere können nur staatliche oder staatlich anerkannte Ausbildungsnachweise akzeptiert werden. Die Gleichwertigkeit des Ausbildungsnachweises wird von den Schweizer Behörden beurteilt, und es können bei wesentlichen Unterschieden zu den hiesigen Ausbildungen sogenannte Ausgleichsmassnahmen angeordnet werden. Damit soll den Staatsangehörigen der Vertragsparteien ein nichtdiskriminierendes System des Zugangs zu wirtschaftlichen Tätigkeiten garantiert werden.
Flankierende Massnahmen
Die Schweiz hat ein hohes Lohnniveau und gute Arbeitsbedingungen. Um zu verhindern, dass die Personenfreizügigkeit zu Lohndruck und Arbeitslosigkeit führt, wurden 2004 flankierende Massnahmen eingeführt. Im Grundsatz sollen die flankierenden Massnahmen die Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz garantieren und einen fairen Wettbewerb zwischen in- und ausländischen Unternehmen gewährleisten. Wer also in der Schweiz arbeitet, soll einen Schweizer Lohn erhalten und zu Schweizer Arbeitsbedingungen beschäftigt werden. Inspektoren führen zu diesem Zweck gezielte Kontrollen in den Betrieben durch und können in gewissen Fällen Bussen ausstellen oder gar Verbote der Dienstleistungserbringung in der Schweiz von bis zu fünf Jahren auferlegen. In der Praxis ist es daher von Bedeutung, bei Entsendungen in die Schweiz sicherzustellen, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen den regionalen und branchenüblichen Anforderungen entsprechen.
Systeme der sozialen Sicherheit
Das Freizügigkeitsabkommen koordiniert ferner auch die Sozialversicherungen. Ziel der Koordination ist es, sicherzustellen, dass EU-/EFTA-Bürger, die zu Wohn- oder Arbeitszwecken in die Schweiz wechseln, nicht wegen des Landeswechsels benachteiligt werden. Das Freizügigkeitsabkommen ist auf alle Zweige der sozialen Sicherheit anwendbar: Leistungen bei Alter, Tod, Invalidität, Mutterschaft, Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit sowie Familienleistungen. Die Sozialhilfe wird hingegen vom Abkommen nicht berührt.
FAQ
Welche Staatsangehörigen profitieren vom Abkommen über die Personenfreizügigkeit?
In den Genuss der vollen Personenfreizügigkeit kommen Staatsangehörige der EU-Länder, sprich Bürger von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Malta, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Ebenfalls Anwendung findet das Abkommen für Staatsangehörige aus dem Fürstentum Liechtenstein, Island und Norwegen und der Schweiz (EFTA-Staaten).
Inwiefern werden nicht EU-/EFTAStaatsangehörige vom Abkommen erfasst?
Staatsangehörige ausserhalb der EU/EFTA sind vom Abkommen grundsätzlich nicht erfasst. Ausnahmen bestehen beim Familiennachzug und für entsandte Arbeitnehmende. Im Rahmen des Familiennachzugs spielt die Nationalität der nachzuziehenden Familienmitglieder keine Rolle. Ebenso dürfen Arbeitnehmende, welche keine EU-/EFTA-Bürger sind, aber bereits seit mindestens zwölf Monaten auf dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats der EU/EFTA zugelassen waren, in die Schweiz entsendet werden.
Welche Dokumente werden für die Einreise in die Schweiz benötigt?
Grundsätzlich können EU-/EFTA-Bürger mit einer gültigen Identitätskarte oder einem gültigen Reisepass in die Schweiz einreisen; es wird kein Visum für die Einreise benötigt. Ein Visum kann hingegen für den Familiennachzug von nicht EU-/EFTA-Staatsangehörigen – je nach Nationalität – von den Grenzbeamten verlangt werden.
Welche Dokumente werden von den Schweizer Migrationsbehörden zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung respektive Arbeitsbewilligung gefordert?
In der Regel genügen ein gültiger Ausweis und ein Arbeitsvertrag, um sich in der Schweiz anzumelden und arbeiten zu dürfen. Um eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung erteilt zu bekommen, muss man sich nach der Einreise in die Schweiz innert 14 Tagen persönlich bei der zuständigen Einwohnerkontrolle melden und ein Aufenthaltsgesuch einreichen, wenn der Aufenthalt länger als 90 Arbeitstage dauern soll. Das Gesuch wird von der Einwohnerkontrolle ans kantonale Migrationsamt weitergeleitet. Wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung erfüllt sind, stellt das Migrationsamt den entsprechenden Ausländerausweis aus.
Ist es EU-/EFTA-Staatsangehörigen erlaubt, den Arbeitsplatz zu wechseln oder innerhalb der Schweiz umzuziehen?
EU-/EFTA-Staatsangehörige profitieren von der beruflichen und geografischen Mobilität. Das bedeutet, sie können jederzeit den Beruf wechseln, sich selbstständig machen und auch den Wohnort wechseln. Wichtig ist, den Wechsel jeweils innert 14 Tagen der zuständigen Wohngemeinde zu kommunizieren.
Kann eine Aufenthaltsbewilligung wegen unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unfall entzogen werden?
Die Aufenthaltsbewilligung kann in einem solchen Fall nicht entzogen werden. Jedoch benötigt man bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit eine vom zuständigen Arbeitsamt ausgestellte Bescheinigung über die unverschuldete Arbeitslosigkeit.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Februar 2023 von personalSCHWEIZ erschienen.
- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Mobilität von Arbeitnehmenden: Personenfreizügigkeit im EU-/EFTA-Raum