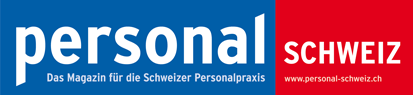- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Intellectual Property im Arbeitsverhältnis: Wem gehört der geistige Output des Arbeitnehmers?
Praxisfälle
Intellectual Property im Arbeitsverhältnis: Wem gehört der geistige Output des Arbeitnehmers?

Geistiges Eigentum (oder englisch Intellectual Property, IP) ist gesetzlich primär durch die vier klassischen Immaterialgüterrechte geschützt. Urheberrechte bestehen an geistigen Schöpfungen der Literatur und Kunst mit individuellem Charakter sowie an Computerprogrammen. Das Urheberrecht ist das einzige Immaterialgüterrecht, das in der Schweiz automatisch entsteht und somit nicht registriert werden muss. Als Marken können Worte, Bilder, Word-Bild-Kombinationen und andere Zeichen eingetragen werden, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens kennzeichnen. Als Designs schützbar sind innovative äussere Gestaltungen von Produkten. Und Patente schliesslich schützen neue Erfindungen im Sinne technischer Problemlösungen.
Schöpferprinzip vs. IP als Arbeitsprodukt
Im Allgemeinen beruht das Immaterialgüterrecht auf dem Grundsatz, dass ein immaterielles Gut derjenigen Person gehört, die dieses geschaffen hat.1 Damit steht das Eigentum grundsätzlich der Urheberin, dem Marken-Kreateur, der Designerin bzw. dem Erfinder persönlich zu. Nun bildet aber in vielen Arbeitsverhältnissen die Schaffung geistigen Eigentums durch den Arbeitnehmer das eigentliche Arbeitsprodukt: Der Arbeitnehmer ist ausdrücklich dafür angestellt und bezahlt, dass er im Rahmen seiner Tätigkeit Werke, Marken, Designs oder Erfindungen entwickelt. Die Arbeitgeberin will den geistigen Output des Arbeitnehmers kommerziell verwerten und hat ein entsprechendes Interesse, dass sie Inhaberin der betreffenden Immaterialgüterrechte ist.
Trotz der grossen Bedeutung, die der Zuordnung der Rechte an immateriellen Arbeitsergebnissen in der Praxis zukommt, regelt das Gesetz diese nur teilweise. Art. 332 des schweizerischen Obligationenrechts (OR) ordnet die Rechte an Erfindungen und Designs zu, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis entstehen. Eine punktuell parallele Regelung sieht Art. 17 des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes (URG) für im Arbeitsverhältnis geschaffene Computerprogramme vor. Für alle anderen Arten von immateriellen Gütern besteht keine gesetzliche Regelung.
Gesetzliche Regeln für Erfindungen, Designs und Software
Mit Blick auf Erfindungen und Designs unterscheidet Art. 322 OR zwischen sogenannten Diensterfindungen/-designs auf der einen Seite und sogenannten Gelegenheitserfindungen/- designs auf der anderen Seite.
Diensterfindungen/-designs sind solche, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten entwickelt: Der Arbeitnehmer ist mithin dazu angestellt, derartige Leistungen hervorzubringen. Gelegenheitserfindungen/-designs werden demgegenüber von Arbeitnehmern geschaffen, die an sich nicht zum Erfinden oder Designen angestellt sind. Sie entstehen zwar auch in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung der vertraglichen Pflichten. Eine Diensterfindung dürfte beispielsweise bei einem Maschinenbauingenieur vorliegen, der im Rahmen seiner Anstellung in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung einer Aufzugherstellerin ein neuartiges Schaltsystem entwickelt. Wenn aber etwa ein Servicetechniker dieses Schaltsystem entwickeln würde, ist dieser als Gelegenheitserfinder zu qualifizieren.
Unterschiede für Dienst- und Gelegenheitserfindungen/-designs
Während Diensterfindungen/-designs originär der Arbeitgeberin zustehen und sie dem Arbeitnehmer hierfür keine zusätzliche Entschädigung schuldet (vgl. Art. 322 Abs. 1 OR), gehören Gelegenheitserfindungen/- designs grundsätzlich dem Arbeitnehmer. Die Arbeitgeberin kann sich aber durch schriftliche Vereinbarung (sog. Erfinder- bzw. Designerklausel) das Recht vorbehalten, sie zu erwerben (Art. 322 Abs. 2 OR). Damit dieses Recht wahrgenommen werden kann, ist der Arbeitnehmer, der einer Erfinder-/ Designerklausel untersteht, verpflichtet, die Arbeitgeberin über die Entstehung von Gelegenheitserfindungen/-designs schriftlich zu informieren. Die Arbeitgeberin muss danach ihrerseits innerhalb von sechs Monaten schriftlich mitteilen, ob sie von ihrem Erwerbsrecht Gebrauch machen will (Art. 322 Abs. 3 OR). Tut sie dies, schuldet sie dem Arbeitnehmer gemäss Art. 322 Abs. 4 OR zusätzlich zum sonstigen Arbeitsentgelt eine besondere angemessene Vergütung, deren Höhe unter Berücksichtigung aller Umstände (z.B. wirtschaftlicher Wert, Mitwirkung der Arbeitgeberin, Inanspruchnahme anderer Mitarbeitender und Betriebseinrichtungen, Aufwendungen und Stellung des Arbeitnehmers) festzusetzen ist.
Sowohl bei Dienst- als auch bei Gelegenheitserfindungen, welche die Arbeitgeberin übernimmt, verbleibt dem betreffenden Arbeitnehmer jedenfalls die sogenannte Erfinderehre, also das Recht, als Erfinder genannt zu werden. Dasselbe gilt gemäss wohl überwiegender Ansicht auch betreffend Designernennung.2
Freie Erfindungen/Designs
Abzugrenzen von den Dienst- und Gelegenheitserfindungen/- designs sind die freien oder arbeitsfremden Erfindungen/ Designs. Diese entstehen zwar auch während der Dauer des Arbeitsverhältnisses, aber ausserhalb desselben, also weder in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit noch in Erfüllung der vertraglichen Pflichten. Sie sind im Gesetz nicht geregelt und stehen grundsätzlich dem Arbeitnehmer zu. Liegt die Erfindung bzw. das Design in einem völlig anderen Bereich als die Geschäftstätigkeit der Arbeitgeberin, besteht grundsätzlich keine Informationsoder Angebotspflicht. Besteht jedoch eine gewisse Nähe, ergibt sich regelmässig eine Informationspflicht, damit die Arbeitgeberin prüfen kann, welche Art von Leistung vorliegt. Die wohl vorherrschende, aber nicht unumstrittene Meinung leitet hier zudem aus der Treuepflicht des Arbeitnehmers (Art. 321a OR) in gewissen Konstellationen, namentlich wenn eine eigene Verwertung die Arbeitgeberin konkurrenzieren würde, gleichwohl eine Angebotspflicht (mit entsprechender Entschädigungsfolge) ab.3
Umfassende vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten
Die Zuordnung der Rechte an Erfindungen und Designs im Arbeitsverhältnis kann in Abweichung von Art. 332 OR weitgehend frei vertraglich gestaltet werden. Einzig Art. 332 Abs. 4 OR betreffend die zusätzliche Entschädigung von Gelegenheitserfindungen/-designs kann nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden (vgl. Art. 362 OR). So kann etwa der originäre Rechtserwerb der Arbeitgeberin auch für Gelegenheitserfindungen/- designs oder im Rahmen des gesetzlich Zulässigen auch eine Angebotspflicht für freie Erfindungen/Designs abgemacht werden.4
Fragmentarische Regelung für Computerprogramme
Wird in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung der vertraglichen Pflichten eine Software programmiert, stehen die Verwendungsbefugnisse gemäss Art. 17 URG ausschliesslich der Arbeitgeberin des Programmierers zu. Damit enthält Art. 17 URG für den Software- Bereich die parallele Regelung zu Art. 322 Abs. 1 OR für Diensterfindungen/- designs. Anders als Art. 322 OR regelt Art. 17 URG die «Gelegenheitssoftware » allerdings nicht. Für diese gelten mithin die allgemeinen Grundsätze und insbesondere das Schöpferprinzip. Art. 17 URG ist gänzlich dispositiv, und entsprechend können Arbeitgeberin und Arbeitnehmer die Zuordnung von Rechten an Computerprogrammen vertraglich grundsätzlich frei vereinbaren.
Andere IP-Rechte im Arbeitsverhältnis: keine Antwort im Gesetz
Im Arbeitsverhältnis entstehen regelmässig auch andere immaterielle Arbeitsergebnisse (z.B. markenfähige Zeichen oder urheberrechtlich geschützte Werke). Das Gesetz gibt keine Antwort auf die Frage, wie die Rechte an solchen immateriellen Gütern zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmer zugeordnet werden.
Markenrechte häufig unstrittig
Im Markenbereich dürften Situationen, in denen die Rechtezuordnung unklar ist, in der Praxis selten sein. Die Marke dient als Kennzeichen zur Unterscheidung von Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens, ist mithin eng mit dem Produkt und dem Unternehmen verbunden und weniger mit der Person, welche die Marke kreiert hat. Entwickelt ein Arbeitnehmer eine Marke für ein Produkt der Arbeitgeberin, wird somit regelmässig unstrittig sein, dass die Rechte daran bei der Arbeitgeberin liegen sollen. Und kreiert er umgekehrt eine Marke, die nichts mit den Angeboten der Arbeitgeberin zu tun hat, steht zumindest immaterialgüterrechtlich5 nichts entgegen, dass er diese Marke selbst registriert.
Urheberrechte als Zankapfel
Unklarer ist die Rechtslage bei immateriellen Arbeitsleistungen, die unter das Urheberrecht fallen können, wie zum Beispiel Texte, Bilder, Videos oder akustische Werke. Hier gilt grundsätzlich das urheberrechtliche Schöpferprinzip, wonach das Urheberrecht dem Arbeitnehmer als Schöpfer des Werks zusteht. In der Folge stellt sich allerdings die Frage, inwiefern die Rechte aufgrund des bestehenden Arbeitsverhältnisses auf die Arbeitgeberin übergehen.
Wenn dazu keine vertragliche Vereinbarung besteht, gilt die sogenannte Zweckübertragungstheorie. Sie besagt, dass bei im Vertragsverhältnis geschaffenen Werken die Rechte in demjenigen Umfang, wie es der Vertragszweck erfordert, auf den Vertragspartner übergehen, dem die Werkerstellung versprochen wurde. Was dies jedoch genau heisst, kann im Einzelfall schwierig zu bestimmen sein.6
Zwar dürfte es jedenfalls bei Arbeitnehmern, die explizit für derartige kreative Tätigkeiten angestellt sind (z.B. Journalisten, Architekten oder Grafiker), regelmässig bedeuten, dass gewisse Nutzungsrechte automatisch und ohne zusätzliche Entschädigung auf die Arbeitgeberin übergehen. Hier kann die Situation mit den Diensterfindungen/-designs verglichen werden. Jedoch ist bei Anwendung der Zweckübertragungstheorie unter Umständen nicht klar, in welchem Ausmass dieser Rechteübergang erfolgt (z.B. Änderungsrecht). Ebenfalls heikel und gegebenenfalls streitig kann die Zuordnung bei Werken sein, die zwar einen Bezug zur Arbeitstätigkeit haben, aber nicht zur Aufgabenerfüllung gehören («Gelegenheitswerke »), sowie bei Werken, die klarerweise nicht im Rahmen des Arbeitsverhältnisses geschaffen wurden («freie Werke»), aber für die Arbeitgeberin gleichwohl interessant sein könnten. In diesem Kontext stellen sich trotz gänzlich fehlender gesetzlicher Ordnung ähnliche Fragen wie bei Erfindungen und Designs. So könnte sich auch hier je nach Konstellation eine Angebotspflicht aus der arbeitsrechtlichen Treuepflicht ergeben. Und unabhängig davon, ob ein Rechteübergang stattfindet, dürfte dem Arbeitnehmer grundsätzlich jedenfalls das urheberpersönlichkeitsrechtliche Recht auf Urhebernennung verbleiben.
IP-Rechte vertraglich klar regeln
Angesichts der beschriebenen Unklarheiten empfiehlt es sich, im Arbeitsvertrag oder mit separater Vereinbarung klar zu regeln, wie mit im Arbeitsverhältnis geschaffenen urheberrechtlich geschützten Werken zu verfahren ist. Obwohl für Designs, Erfindungen und Software gewisse gesetzliche Regeln bestehen, bietet es sich an, im Zuge einer vertraglichen Vereinbarung umfassend alle relevanten Kategorien immaterieller Arbeitsergebnisse zu erfassen und in einer dem konkreten Einzelfall angemessenen Regelung abzubilden.
Fussnoten
1 Insbesondere im Urheberrecht wird dieser Grundsatz als Schöpferprinzip bezeichnet.
2 Vgl. Portmann, W. & Rudolph, R. (2020). Kommentar zu Art. 332 OR, N. 7. BSK – Basler Kommentar Obligationenrecht I (7. Auflage). Basel: Helbing Lichtenhahn; Rehbinder, M. & Stöckli, J. (2014). Kommentar zu Art. 332 OR, N. 10. BK – Berner Kommentar Obligationenrecht (2. Auflage). Bern: Stämpfli; Truniger, P. (2023). Kommentar zu Art. 332 OR, N. 6. OFK – Orell-Füssli Kommentar Obligationenrecht (4. Auflage). Zürich: Orell-Füssli; betreffend Designs a.M. Emmel, F. (2023). Kommentar zu Art. 332 OR, N. 2. CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (4. Auflage). Zürich: Schulthess.
3 Vgl. Müller, B. (2021). Kommentar zu Art. 332 OR, N. 39. SHK – Stämpflis Handkommentar Obligationenrecht. Bern: Stämpfli; Protmann/Rudolph (Fn. 2), N. 12 f.; Rehbinder/Stöckli (Fn. 2), N. 21; Truniger (Fn. 2), N. 12; a.M. etwa Emmel (Fn. 2), N. 3.
4 Vgl. etwa Rehbinder/Stöckli (Fn. 2), N. 22.
5 Auch hier sind selbstredend Konstellationen denkbar, in denen der Arbeitnehmer, der beispielsweise eine Marke für ein Konkurrenzunternehmen entwickelt, seine arbeitsrechtliche Treuepflicht (Art. 321a OR) verletzt. Die Zuordnung der Markenrechte beschlägt dieser Umstand jedoch nicht direkt.
6 Vgl. zum Ganzen statt vieler nur Portmann/Rudolph (Fn. 2), N. 1 f.
(Dieser Praxisfall ist in der Ausgabe Februar 2025 von personalSCHWEIZ erschienen)
- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Intellectual Property im Arbeitsverhältnis: Wem gehört der geistige Output des Arbeitnehmers?