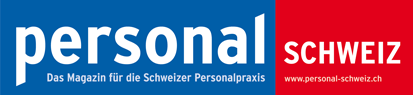- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Ermessensabhängige Gratifikation und Leistungslohn: Zielvereinbarung oder -vorgabe bei variabler Vergütung
Praxisfälle
Ermessensabhängige Gratifikation und Leistungslohn: Zielvereinbarung oder -vorgabe bei variabler Vergütung

Bei der Ausgestaltung von einer variablen Vergütung gibt es rechtlich gesehen zwei Modelle. Das Vergütungsmodell kann entweder als ermessensabhängige Gratifikation oder als Leistungslohn ausgestaltet werden. Beim Leistungslohn werden messbare Ziele vorausgesetzt, die einseitig vorgegeben oder miteinander vereinbart werden. Aber auch beim Gratifikationsmodell können Zielvorgaben oder Zielvereinbarungen bestehen, die jedoch keinen direkten Einfluss auf die variable Vergütung haben, sondern bloss beim internen Vergütungsfestsetzungsprozess mitberücksichtigt werden.
Ermessensabhängige Gratifikation
Eine variable Vergütung kann arbeitsrechtlich rein ermessensabhängig ausgestaltet werden, sodass die Zahlung der variablen Vergütung (Gratifikation) sowie deren Höhe vom freien Ermessen der Arbeitgeberin abhängig sind. Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe eine variable Vergütung als Gratifikation gewährt wird, kann individuell für die Mitarbeitenden oder auch für ein Team oder eine Abteilung erfolgen. Typischerweise werden bei der Festlegung der Gratifikation das Jahresergebnis der Arbeitgeberin sowie die Leistung und das Verhalten des Mitarbeitenden im massgebenden Geschäftsjahr angemessen mitberücksichtigt. Aufgrund des freien Ermessens kann die Leistung des Mitarbeitenden nicht nur an wirtschaftlichen Resultaten gemessen werden, sondern auch von weiteren Punkten abhängig gemacht werden. Beispiele dafür sind etwa, ob die Geschäftspolitik der Arbeitgeberin nachgelebt wird, die Kundeninteressen im Sinne der Arbeitgeberin gewahrt werden sowie gutes Führungsverhalten, gute Teamarbeit oder ein beruflich und persönlich korrektes Verhalten gegeben sind. Zudem ist es möglich, die Gratifikation bei Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten oder Verstössen gegen interne oder externe Vorschriften ganz zu streichen oder zu reduzieren. Bei einer solchen variablen Vergütung, ausgestaltet als Gratifikation, werden in der Regel auch Verfallsklauseln vereinbart, sodass bei einem unterjährigen Austritt eben kein Pro-rata-Anspruch auf eine Zahlung besteht. Zudem kann die Auszahlung auch generell von der Bedingung abhängig gemacht werden, dass sich die Mitarbeitenden zum Auszahlungszeitpunkt in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden müssen.
Auch wenn die variable Vergütung ermessensabhängig ist und nicht an die Erreichung bestimmter Ziele gekoppelt ist, können selbstredend unabhängig davon dem Mitarbeitenden Ziele für das jeweilige Geschäftsjahr oder für eine andere Zeitperiode einseitig vorgegeben oder gemeinsam vereinbart werden. Diese können dann eben bei der Festlegung der variablen Vergütung mitberücksichtigt werden. Mitarbeitende wissen aber wegen der Ermessensabhängigkeit nicht, welche Zielerfüllung was für einen konkreten finanziellen Einfluss hat. In der Unternehmenspraxis lassen sich solche Modelle auch finden, die dann vorsehen, dass eine ausbezahlte Gratifikation anteilsmässig zurückbezahlt werden muss, wenn Mitarbeitende das Unternehmen in einer bestimmten Zeit nach der Auszahlung (z.B. drei Jahre) verlässt. Durch einen solchen Rückzahlungsmechanismus erhält die variable Vergütung eine Retentionskomponente.
Messbare Ziele beim Leistungslohn
Beim Leistungslohn werden messbare Kriterien vorgegeben, und wenn die jeweiligen definierten Ziele erfüllt sind, dann ist die variable Vergütung im entsprechenden Umfang geschuldet. Die relevanten Ziele knüpfen in der Regel an der Leistung des Unternehmens (Unternehmensziele) sowie an der persönlichen Leistung des entsprechenden Mitarbeitenden an. In diesem Zusammenhang stellt sich immer wieder die Frage, was gilt, wenn zwar das Unternehmen die Leistung erbracht hat und die Unternehmensziele erreicht worden sind, der Mitarbeitende seine messbaren Ziele jedoch nicht erreicht hat. Hier muss sich die Arbeitgeberin bei der Ausgestaltung des Vergütungsmodells die Frage stellen, ob eine variable Vergütung immer bereits im definierten Umfang bezahlt werden soll, sobald die Unternehmensziele erfüllt sind. Oder ob der Grundsatz «ohne Fleiss kein Preis» gelten soll, sodass eine variable Vergütung nur geschuldet sein soll, wenn die individuellen Ziele vollständig oder zu einem bestimmten Grad erfüllt sind. Damit Mitarbeitende, die ihre persönlichen Ziele nicht erreichen, nicht übermässig incentiviert werden, wenn die Unternehmensziele erfüllt werden, sollte eine klare Regelung getroffen werden. Es ist sinnvoll festzuhalten, dass die variable Vergütung nur dann ausbezahlt wird, wenn der betroffene Mitarbeitende mindestens 50% (oder mehr) seiner individuellen Ziele erreicht hat. Wird diese Schwelle nicht erreicht, besteht ausdrücklich kein Anspruch auf eine variable Vergütung – selbst dann nicht, wenn die Unternehmensziele ganz oder teilweise erfüllt sind.
Eine solche Regelung macht Sinn, zumal für den Mitarbeitenden die Erfüllung der persönlichen Ziele beeinflussbarer ist als die Erreichung der Unternehmensziele. Er wird somit dazu motiviert, durch die Erreichung der persönlichen Ziele dazu beizutragen, dass auch die Unternehmensziele erreicht werden. Zeitgleich stellt sich bei der Gestaltung des Vergütungsmodells eine wichtige Frage: Soll ein Mitarbeitender eine variable Vergütung im Umfang der erreichten persönlichen Ziele erhalten, auch wenn die Unternehmensziele nicht in einem Mindestmass erfüllt wurden? Oder soll die Auszahlung der variablen Vergütung stets davon abhängen, dass sowohl eine Mindestschwelle der Unternehmensziele als auch der persönlichen Ziele erreicht wird?
Zielvorgabe oder Zielvereinbarung
Bei der Ausgestaltung des Vergütungsmodells als Leistungslohn sollte auch wohlüberlegt sein, ob die Ziele einseitig durch die Arbeitgeberin vorgegeben werden oder mittels Vereinbarung gemeinsam festgelegt werden müssen. Bei einer gemeinsamen Zielvereinbarung wird selbstredend ein Konsens über die Ziele vorausgesetzt, und die Zielverständigung ist sicher zeitaufwendiger als eine einseitige Zielvorgabe. Dafür hat eine Zielvereinbarung den Vorteil, dass die gemeinsam festgelegten Ziele nicht infrage gestellt werden im Vergleich zu einseitig vorgegebenen Zielen. Bei der Festlegung der persönlichen Ziele – egal ob mittels Vereinbarung oder durch einseitige Vorgabe – sollten diese so festgelegt werden, dass Mitarbeitende eine realistische Chance haben, die Ziele zu erreichen. Sofern eine gemeinsame Zielfestlegung vorgesehen ist, macht es Sinn, in jedem Fall vertraglich zu definieren, was gilt, wenn keine Einigung in Bezug auf die zu erreichenden Ziele besteht. Für diesen Fall kann zum Beispiel vereinbart werden, dass die Arbeitgeberin dann die Ziele einseitig vorgeben darf, oder aber, dass die letztjährigen Ziele weiterhin Geltung haben, allenfalls mit einem Erhöhungsmechanismus. Unabhängig davon, ob die Ziele durch Vereinbarung oder Vorgabe festgelegt werden, ist es wichtig, dass die Zielfestlegung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres tatsächlich erfolgt und nicht vergessen geht. Ansonsten besteht nämlich die Gefahr, dass ohne Weiteres von einer Zielerreichung von 100% ausgegangen werden muss.
(Dieser Praxisfall ist in der Ausgabe Mai 2025 von personalSCHWEIZ erschienen)
- Fachmagazin
- Praxisfälle
- Ermessensabhängige Gratifikation und Leistungslohn: Zielvereinbarung oder -vorgabe bei variabler Vergütung