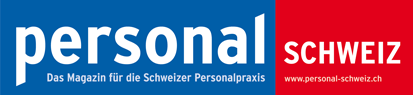- Fachmagazin
- Experten-Interviews
- Case Management, Arbeitsunfähigkeit & Kündigung: «Oft wird zu lange abgewartet»
Experten-Interviews
Case Management, Arbeitsunfähigkeit & Kündigung: «Oft wird zu lange abgewartet»

Jana Renker, Leiterin Case Management bei ZURZACH Care
Jana Renker, wie erleben Sie in Ihrer Rolle als Leiterin Case Management die Entwicklung von Arbeitsunfähigkeiten in den letzten Jahren?
Die durchschnittliche Absenzdauer ist gemäss Bundesamt für Statistik in den letzten zehn Jahren um fast 30% gestiegen – von 6,6 auf 8,5 Tage. Nach der Coronapandemie hat sich das Niveau nicht erholt, im Gegenteil: Von 2023 auf 2024 verzeichneten wir erneut einen deutlichen Anstieg. Parallel verändert sich die Art der Arbeitsunfähigkeiten. Während körperliche, neurologische und psychische Ursachen generell zunehmen, wächst der Anteil psychisch bedingter Ausfälle überproportional. Häufig liegen heute mehrere Faktoren vor – körperliche, psychische und soziale –, die sich gegenseitig verstärken. Themen wie Vereinbarkeit, emotionale Anforderungen oder Konflikte im Arbeitsalltag führen zu komplexen Mehrfachproblematiken.
Welche Rolle spielen psychische Belastungen heute im Vergleich zu physischen Erkrankungen?
Physische Erkrankungen bleiben relevant, ihre Auswirkungen unterscheiden sich aber je nach Branche und Funktion stark. Eine chronische Knieerkrankung belastet einen Mitarbeiter in einer körperlich belastenden Tätigkeit mehr als in einer Bürotätigkeit. Langfristig lassen sich Arbeitsunfähigkeiten durch Anpassungen oder Umorientierung verbessern. Psychische Erkrankungen sind hingegen oft schwerer greifbar, betreffen sämtliche Lebensbereiche und berufliche Fähigkeiten, und die Heilungsverläufe sind weniger linear. Dies verursacht mehr Unsicherheiten in der Prognose und erhöht das Risiko für Langzeitarbeitsunfähigkeiten.
Sie begleiten Betroffene persönlich – wo spüren Sie die grössten Spannungen zwischen Arbeitgeber, Mitarbeitenden und Versicherungen?
Zwischen Arbeitgebenden und Mitarbeitenden entstehen Spannungen meist durch Unsicherheit und fehlende Klarheit. Arbeitgebende wünschen sich Planbarkeit für die Aufgabenverteilung und Entlastung des Teams. Mitarbeitende sind gesundheitlich und existenziell belastet, vielfach selbst stark verunsichert und können diese Klarheit nicht bieten. Die Versicherungen kommen oft erst später hinzu und benötigen klare objektive medizinische Grundlagen, um über Leistungspflicht, -dauer und -umfang entscheiden zu können.
Was sind die häufigsten Fehler, die Unternehmen im Umgang mit langzeitkranken Mitarbeitenden machen?
Vor allem bei psychischen Erkrankungen wird Kommunikation aus Angst vor Fehlern vermieden. Doch regelmässiger Kontakt ist zentral, um Vertrauen zu erhalten, weil sonst ein Wiedereinstieg zur immer grösser werdenden Hürde wird. Oft wird zu lange abgewartet, in der Hoffnung auf spontane Besserung respektive vollständige Genesung. Hilfreicher ist, vorhandene Ressourcen früh zu nutzen und den Wiedereinstieg schrittweise mit Teilarbeitsfähigkeiten zu planen – das unterstützt die Genesung und schafft Perspektiven.
Wie erkennt man frühzeitig, dass ein Fall «kippt» – also von einer vorübergehenden zu einer längeren Arbeitsunfähigkeit wird?
Es gibt Fälle, die «kippen» unerwartet, wie beispielsweise verlangsamte Genesungsprozesse nach Operationen oder bei Komplikationen. Dann gibt es Erkrankungen und daraus resultierende Arbeitsunfähigkeiten, bei denen wir aufgrund der Erkrankung wissen, dass ein komplexer und langer Verlauf zu erwarten ist. Dazu zählen z.B. Tumorerkrankungen oder neurologische Vorfälle wie Schlaganfälle. Und schliesslich bleiben ganz viele Konstellationen, in denen physische oder psychische Überlastung und Mehrfachproblematiken zu einer schleichenden Chronifizierung führen. Warnsignale sind wiederholte Kurzabsenzen, Leistungsminderung mit schlechterer Arbeitsqualität, sichtbare Erschöpfung, zunehmende Schmerzen, Rückzug oder kognitive Überforderung. In der Arbeitsunfähigkeit zeigen sich «kippende» Fälle an stagnierenden Verläufen, ausbleibenden Fortschritten oder Kommunikationsabbrüchen.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, Case Management einzuschalten, damit eine Rückkehr gelingt?
Sobald Unsicherheiten bestehen. Über die Mitarbeitendenberatung sind wir teilweise bereits präventiv involviert, wenn es erst zu Kurzzeitabsenzen gekommen ist oder erste Warnsignale aufgetreten sind. Hier können wir mit einem adäquaten Unterstützungsrahmen Gegensteuer geben. Im Case Management unterstützen wir ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit alle Beteiligten zeitnah. Wir sorgen für Stabilität, schaffen Klarheit und aktivieren vorhandene Ressourcen. So kann eine mögliche Wiedereingliederung früh geprüft und eingeleitet werden.
Wie läuft ein typischer Fall ab – vom Erstkontakt bis zur Wiedereingliederung oder Kündigung?
Am Anfang des Case Managements steht die Assessmentphase, die mit einem Erstgespräch mit der betroffenen Person und deren Legitimation an uns (Vollmacht) beginnt. Anschliessend vernetzen wir uns mit den medizinischen, betrieblichen und versicherungsrechtlichen Akteuren, woraufhin eine Ziel- und Massnahmenplanung mit der betroffenen Person erfolgt. Zentral ist die Klärung der medizinischen Prognose und Zumutbarkeit sowie die betriebliche Umsetzbarkeit. Während des gesamten Prozesses begleiten wir eng, moderieren den Austausch und prüfen den Weg regelmässig. Idealerweise resultiert eine nachhaltige Wiedereingliederung – manchmal aber auch die Erkenntnis, dass eine Trennung für alle Beteiligten sinnvoller ist.
Welche Faktoren entscheiden, ob eine Wiedereingliederung erfolgreich ist – und woran scheitert es oft?
Die erfolgreiche Wiedereingliederung braucht eine realistische Planung und Tragfähigkeit, eine offene Kommunikation und Anpassungsbereitschaft. Scheitern droht bei unrealistischer Erwartung – etwa wenn Betroffene ihre Belastbarkeit überschätzen und gesundheitliche Bedürfnisse nicht mitteilen. Oder wenn Arbeitgebende eine zu schnelle Rückkehr erwarten respektive die betrieblichen Grenzen oder vorhandene Unsicherheiten nicht offen kommunizieren. Wir begleiten diesen Prozess und koordinieren auch regelmässig mit Ärzten und Versicherungen.
Wie kann das HR sicherstellen, dass der Wiedereinstieg nicht nur organisatorisch, sondern auch menschlich gelingt?
Die menschliche Komponente hängt von der Unternehmenskultur und der Rolle der Führungskräfte als Schlüsselpersonen ab. Unabhängig von einer konkreten Wiedereingliederung sind ein offenes Klima, klare Kommunikation und Wertschätzung im Allgemeinen elementar. Führungskräfte können in den Themen Früherkennung und Gesprächsführung geschult und im konkreten Wiedereingliederungsprozess bei Unsicherheiten unterstützt werden. Für die erkrankten Mitarbeitenden ist wichtig, dass die Rückkehr nicht als «Sonderfall » betrachtet wird, sondern dass sie wieder Teil des Teams sind. Natürlich sind aber auch die organisatorischen Aspekte eine wichtige Unterstützung in der beruflichen Wiedereingliederung.
ZUR PERSON
Jana Renker ist im Januar 2025 bei ZURZACH Care Prävention und Reintegration eingetreten und ist für die Abteilung Prävention und Case Management mit verschiedenen Standorten in der Schweiz verantwortlich. ZURZACH Care unterstützt als neutrale Institution die berufliche Wiedereingliederung im Auftrag von Arbeitgebenden, Versicherungen oder Behörden sowie die Entwicklung von betrieblichen Präventionsangeboten. Zuvor war Jana Renker selbstständig tätig als Case Managerin und eidg. dipl. Sozialversicherungsexpertin. Seit einigen Jahren ist sie zudem aktiv in der Weiterbildung in den Bereichen Sozialversicherungsrecht und beruflicher Wiedereingliederung und als Dozentin an verschiedenen Fachhochschulen anzutreffen.
- Fachmagazin
- Experten-Interviews
- Case Management, Arbeitsunfähigkeit & Kündigung: «Oft wird zu lange abgewartet»